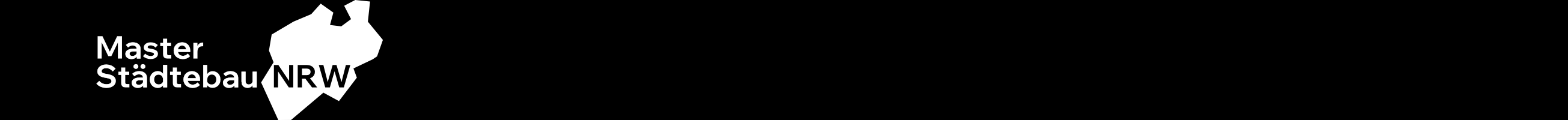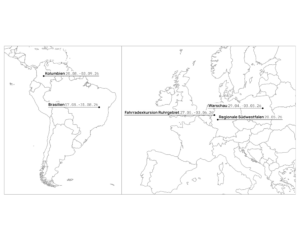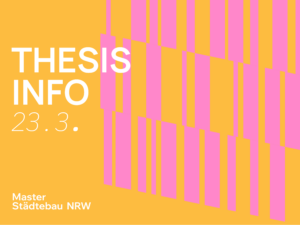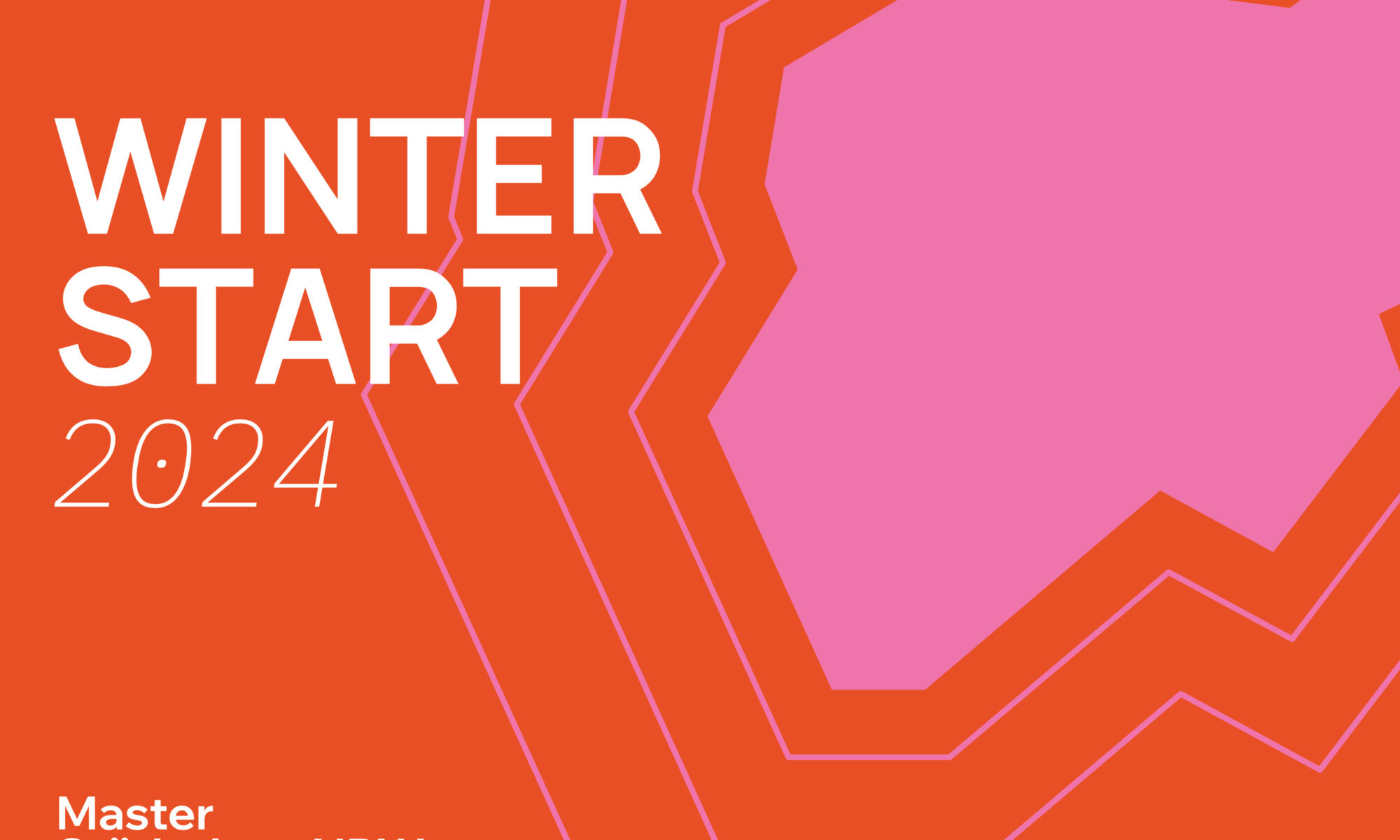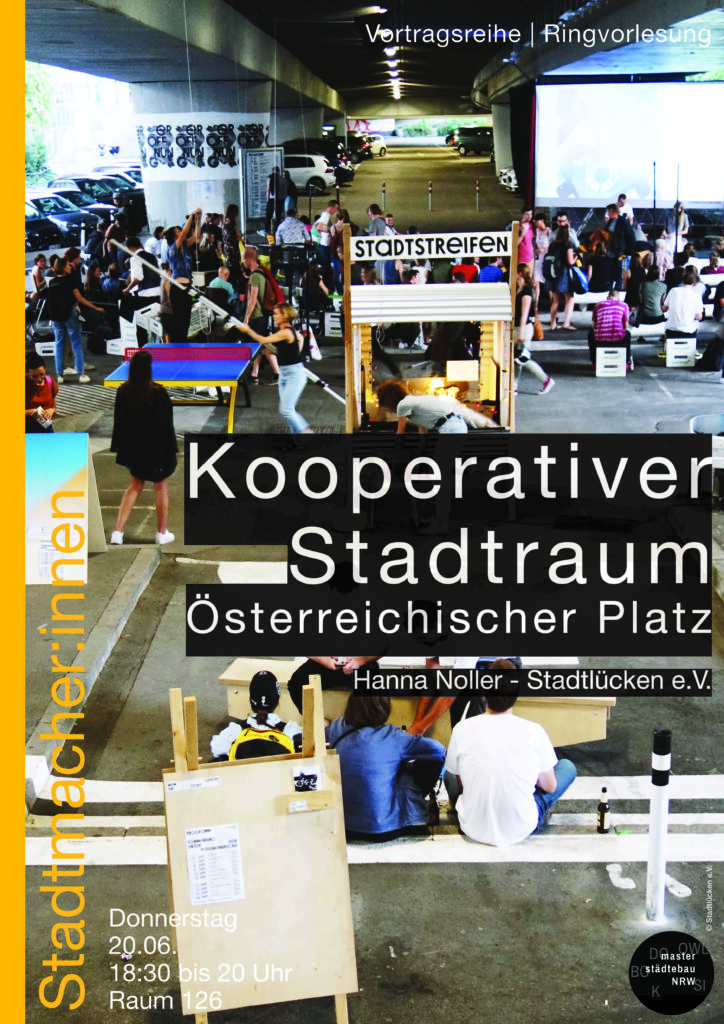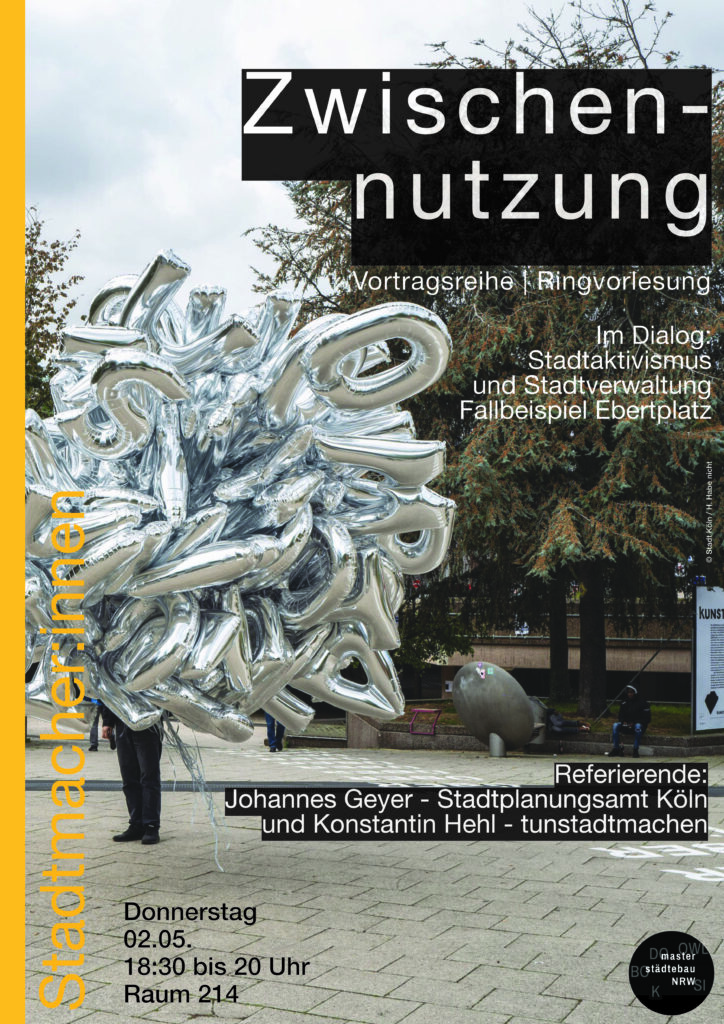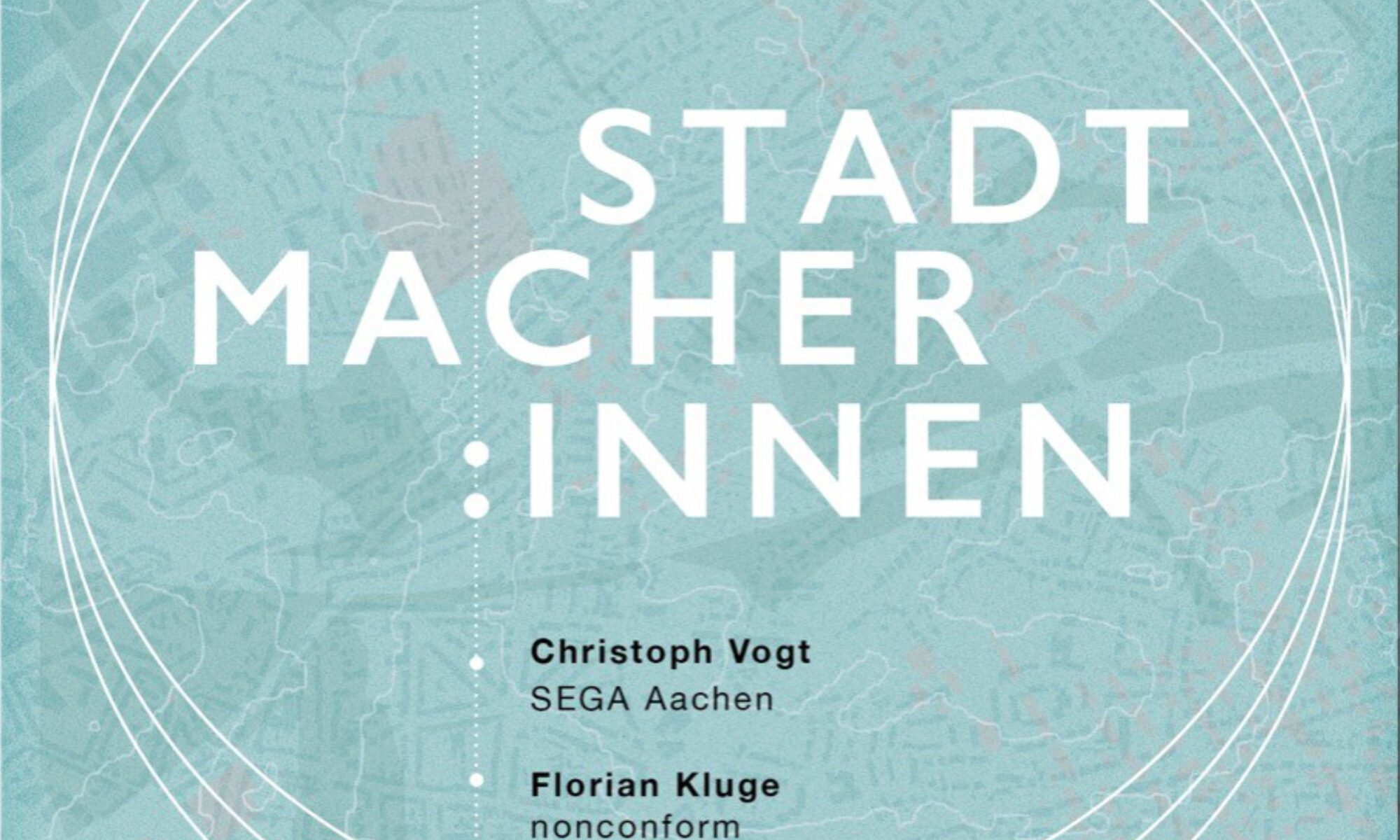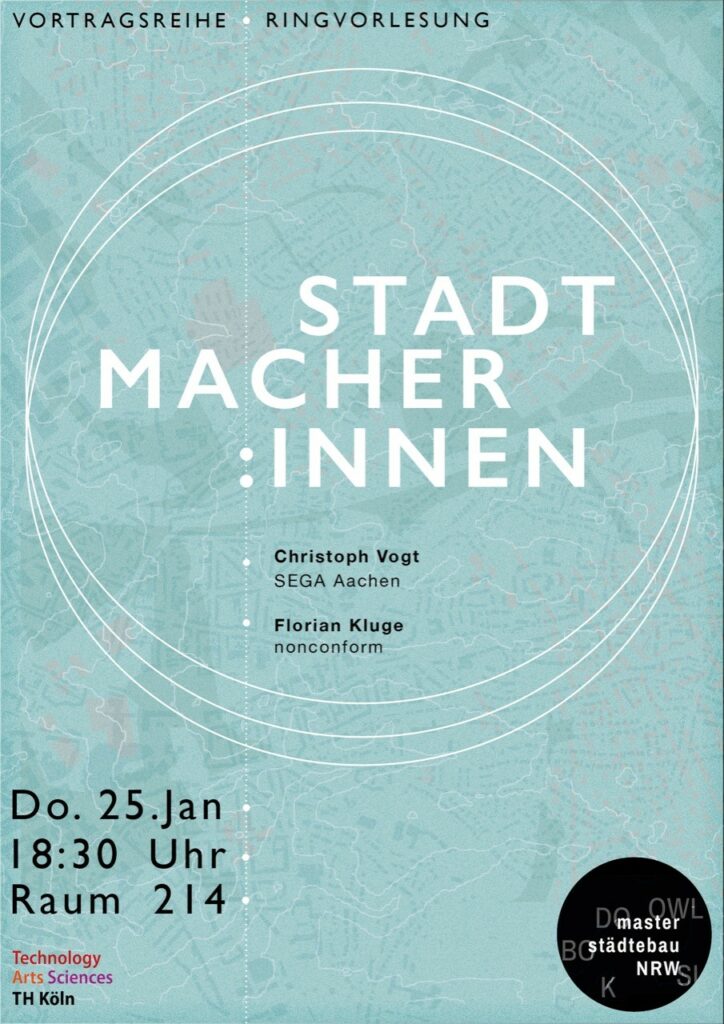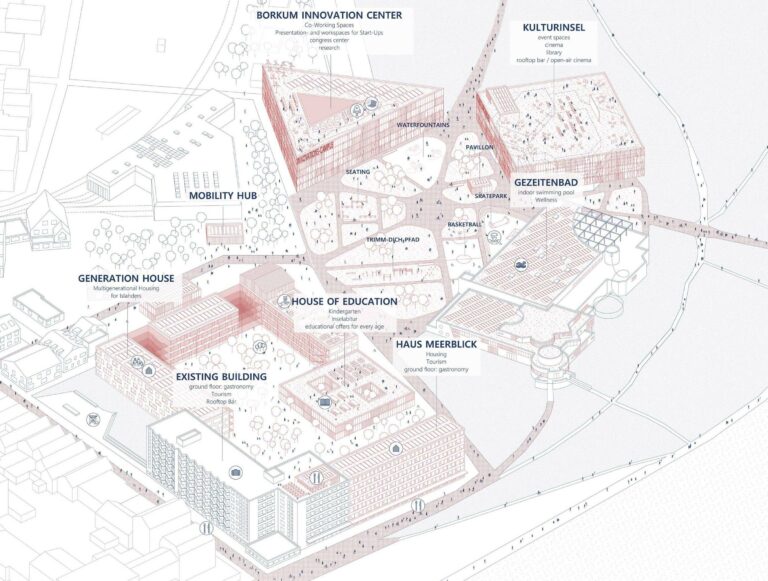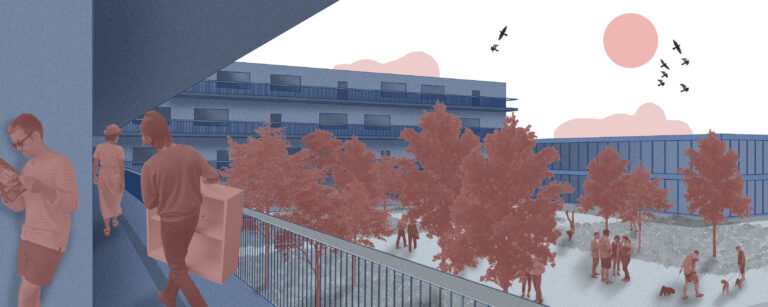Einladung Vortragsreihe
Transformative Planungskultur
ab dem 21. oktober 2024
MontagS | 16:00 bis 17:30Uhr
Kurzbeschreibung:
Ob in der Planungspraxis oder in Forschung und Lehre an den Hochschulen – wir stehen vor drängenden Herausforderungen: Boden-, Bau- und Mobilitätswende, Klimaschutz und Biodiversität, Migration und gesellschaftlicher Zusammenhalt sind nur einige der programmatischen Schlagworte erforderlicher Veränderungen. Es ist höchste Zeit, Wege der transformativen Planung und Entwicklung einzuschlagen und Prozesse sowie Instrumente für die Umsetzung in der Breite zu entfalten. Die universitätsübergreifende Lehrveranstaltung thematisiert die notwendige transformative Planung von Städten und Regionen aus unterschiedlichen fachlichen Perspektiven. Fachliche Inputs werden in Diskussionen reflektiert.
Termine: Montags, 16.00–17.30 Uhr, online
21.10.24
Einführung Prof. Dr. Barbara Engel / Prof. Mario Tvrtković
28.10.24
Die Klima-Apokalypse. Planung als radikale Gestaltungsaufgabe Dipl.-Ing. Axel Schubert, Fachhochschule Nordschweiz
04.11.24
Transforming Neighborhoods: Living Lab Tbilisi Prof. Dr. Barbara Engel, KIT Karlsruhe
11.11.24
Netze knüpfen und lokal intervenieren – Initiativen der Freiraumentwicklung zur urbanen Transformation in Europa Prof. Cornelius Scherzer, HTW Dresden
18.11.24
Sustainable Urban Regions Prof. Frank Schwartze, TH Lübeck
25.11.24
Transformation gestalten Prof. Thorsten Erl, Uni Siegen
02.12.24
tu! Hambach – Essentials eines transdiziplinären und transformativen Lern- und Gestaltungsraums Prof. Dr. Agnes Förster, RWTH Aachen
09.12.24
Gemeinsam Stadt machen – Erfahrungen aus kooperativen Lehrformaten Prof. Yasemin Utku, TH Köln
16.12.24
Haus der Statistik. Ko-Kreation und Partizipation Hon. Prof. Regula Lüscher, stadtmacherin, Zürich
13.01.25
Reflexion
20.01.25
Diskussion

weitere Themen
Exkursionen SoSe26
Überblick über alle Exkursionen im SoSe 26
Zanders-Areal
Einladung zum Sonderformat der Stadtmacher:innen am 06.02.2026
Infoveranstaltung Thesis
zur Master-Thesis am 23.03.2026